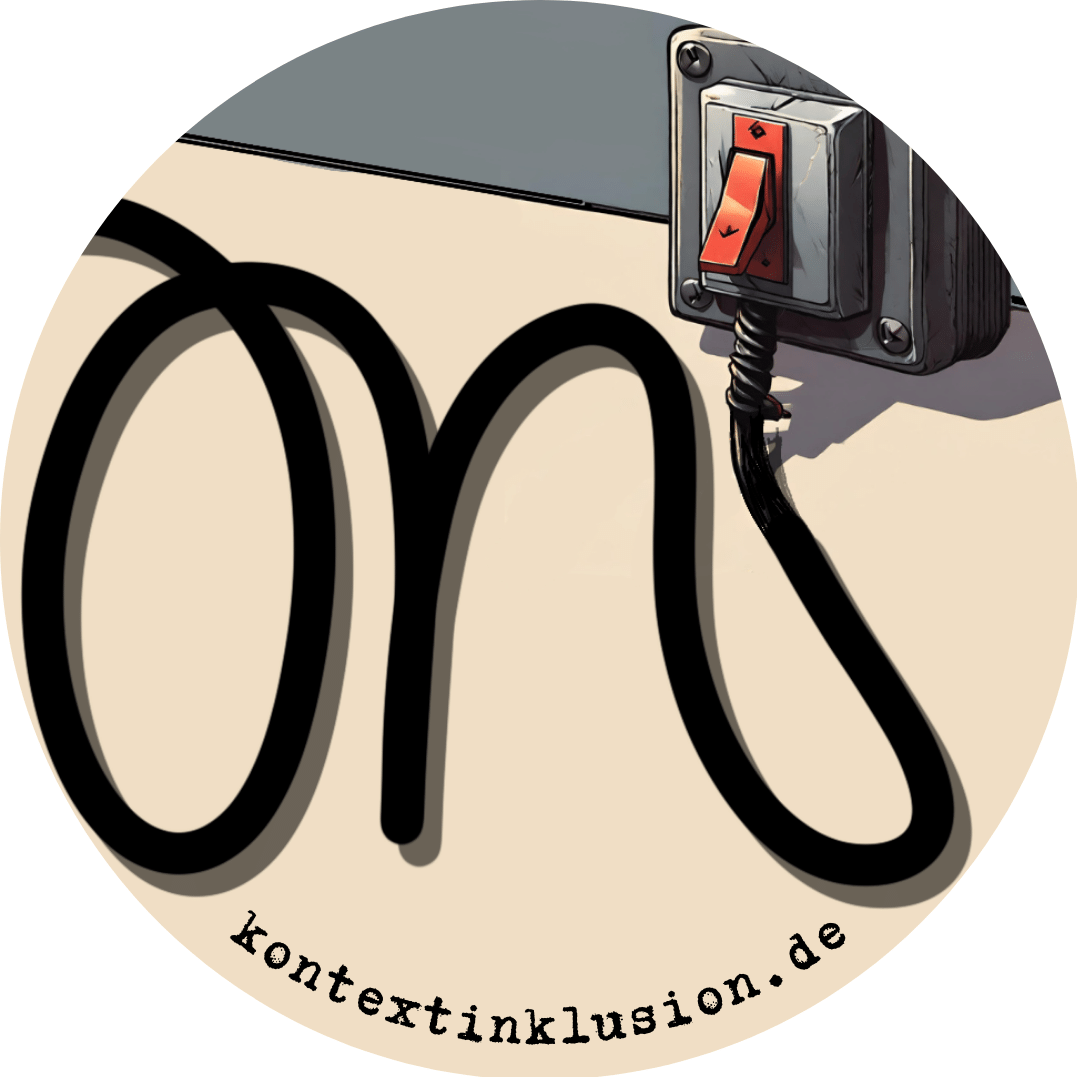Ich bin mal wieder etwas aufgebracht, aber ich habe gelernt zu sagen: Das überfordert mich gerade emotional!
Meine Schulleitung mag ich eigentlich sehr. Und dennoch, vielleicht aufgrund der großen Belastung Lehrkräftemangel und auch durch verschiedene Visionen innerhalb der kollegialen Schulleitung, wie das System Schule zu laufen habe, kommt es zu Spannungen, was das Thema Inklusion angeht.
Ich will nichts kapern, nichts vom Grund auf umkrempeln oder winke mit Pamphleten prophetischer Paradigmenwechsel. Ganz im Gegenteil, ich bin geradezu devot (soweit es sein muss) und harmoniebedürftig. Ich arbeite gern und ich hab manchmal ganz gute Gedanken. Aber ich drängele nicht, ich mache nie Aufstand oder verweigere mich (fast nie).
Und trotzdem wird man jawohl noch grimmig gucken dürfen, wenn man merkt, dass die Stimmung kippt. Dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Offensichtlich gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was Inklusion ist. Wie man mit wem in einer inklusiven Schule arbeitet. Da wird auf Stunden geguckt, da wird das Beratungsschild ganz hoch gehalten, da wird bezweifelt und sich etwas abgewrungen und das fühlt sich nicht gut an. Und so ganz hab ich es auch noch nicht verstanden. Aber ich spüre: das wird zum Problem, es ist eine Frage nach Zuständigkeit, Aufgabenbereich, Selbstverständnis und Überprüfbarkeit.
Wofür bin ich zuständig? Für differenzierten Unterricht. Für alle Angelegenheiten, die über das unterrichtliche Maß hinaus gehen und eine emotionale Belastung für Schüler*innen darstellen. Für Elternarbeit und Kontakt zu außerschulischen Ansprechpartner*innen. Für Papierkram rund um Unterstützungsbedarfe. Für Diagnostik. Fürs Mitdenken von Neurodiversität und Kompensation in allen organisatorischen Belangen.
Ach so! Bist du Klassenlehrkraft? Nö! Häh?
Das Problem liegt im Grunde darin, dass wir Sonderpädagog*innen den Job machen, von dem sich diejenigen, die Ahnung von Inklusion haben, wünschen, dass es so alle Lehrkräfte machen. Was zwangsläufig dazu führen würde, dass man Sonderpädagog *innen eigentlich nicht mehr bräuchte. Auf der andere Seite verteidigt sich die Sonderpädagogik selbst als superwichtig. Und in diesem Spannungsfeld findet man sich an einer Regelschule wieder und erkennt: Das wird so nie Inklusion. Daraus wird eher Burn out – für alle Beteiligten.
Ich befürchte, jetzt, wo die Belastungen nicht verschwinden, wo es immer schwerer fällt, sich in diesem maroden System richtig zu verhalten, da herrscht nicht mehr eitel Sonnenschein bei Themen, die schwerfallen, die man aber erstmal anderen überlassen hat. Was folgt, ist dann entweder ein komplettes Aufbrechen der Herausforderung. Oder man teilt lieber wieder in die gängigen Zuständigkeitsbereiche. Dein Tanzbereich und mein Tanzbereich. Aber das ist falsch.
Als Mutter eines Kindes im Autismus Spektrum mit komorbider Hochbegabung, ADS und, ganz neu, depressiven Episoden blicke ich vielleicht ganz anders auf Inklusion als Schulleitungen. Vielleicht sehen diese nur, wie man Sonderpädagog*innen den Schulen zuteilt, in der SEK I nach sogenannten Rucksackstunden, die Kinder mit zieldifferenter Beschulung mitbringen. Möglicherweise sieht es so aus, als ob sich unsere Arbeit nur um problematische Kinder dreht. Da kommt ihnen schnell der Gedanke, dass das auch zum Ruf der Schule wird. Und es wurde schon offen gesagt: wir brauchen Kinder mit einem Notenbild, das früher mal der Gymnasialempfehlung gleichzusetzen war, oder noch mehr aus dem Mitteltopf, der fällt ja quasi weg, aber was wir nicht brauchen, ist noch mehr Inklusion! Wir wollen ja keine Förderschule 2.0 werden.
Bei der Aussage bleibt einem ja das Herz stehen, so als Mama. Nicht noch mehr Inklusion? Inklusion betrifft doch immer alle. Inklusion ist doch kein anderes Wort für Schüler*innen mit Unterstützungsbedarfen. Mein Sohn ist hochbegabt und war an einer Grundschule, die eine Plakette unseres Bildungsministeriums hatte, die sie als eine Forderstätte für Hochbegabte ausweist. Das ist dieselbe Schule, die weder differenzieren wollte noch Verständnis dafür hatte, was mein Kind schon alles mitbrachte. Es sei schlichtweg schlecht erzogen, so sagte man mir ins Gesicht. Wahrscheinlich weil ich mich erdreistet hatte zu fragen, worin die Hochbegabtenförderung eigentlich bestehe. Ich habe auch beim Kultusministerium angefragt, nach welchen Kriterien Schulen sich diese Auszeichnung ans Revers klemmen dürfen. Ich bekam ausweichende Antworten. In meiner Region sei zudem jemand zuständig, aber der wäre gerade nicht arbeitsfähig. Lachen oder weinen? Hilflos fühlen! Damit war ich viele Jahre beschäftigt. Gestritten habe ich selten. Eigentlich immer nur nachgefragt. (Auch jetzt schäme ich mich, weil ich immer Angst hatte, ich wirke wie eine aufgeblasene Helikoptermutti, die sich Vorteile erstreiten will. Aber so war das nie.)
Soll ich meine Schulleitung jetzt mal fragen, wen sie meint, wenn sie von Inklusion spricht? Die andere IGS, die mein Kind dann in 5 aufgenommen hat, die lebt Inklusion, weil sie es dem Kind möglich macht, möglichst sicher durch die Schuljahre zu kommen. Die haben keine besonderen Programme oder Firlefanz oder noch schlimmer, diese eine MINT-Gruppe zur Abdeckung von Begabtenförderung. Die Schule sieht alle Kinder, versteht und respektiert die Vielfalt. Mein Kind darf dort sein. Er hat auch keinen Unterstützungsbedarf. Alles was er nicht kann, wird kompensiert oder angenommen. Keiner macht Druck. Er kann Teil der Gruppe sein. Seit 8 Jahren. Er macht jetzt sein Abi. Es war nicht immer leicht, aber durch Gespräche, Gemeinschaft, durch Verständnis und Mut, hat es geklappt. Das ist für mich Inklusion. Auch.
Wir brauchen mehr Begabtenförderung, sagt meine Schulleitung. Ich sage: Haben wir schon, könnte besser, aber seht doch, was schon da ist! Wir decken mit begeisterten Lehrkräften schon viele Bereiche ab. Es gibt sogar eine quasi selbstgeleitete AG, die so beliebt ist, dass sie aus allen Nähten platzt. Wir haben begabte Lehrkräfte und begabte Schüler*innen. Inklusion meint immer alle – alle Menschen, alle Begabungen, alle Herausforderungen und alle Zugänge.
Alle Lehrkräfte sollten Diversität im Großen und Ganzen wahrnehmen, anerkennen und verstehen können. Der Unterricht sollte darauf ausgerichtet sein, auf Bedarfe eingehen zu können. Sonderpädagogisches Wissen sollte allgemein mitgelehrt werden in allen Bildungsgängen. Das Gros würde sich aber durch gemeinsam geteilte Erfahrung in Netzwerken und Schwerpunktfortbildungen ergeben, je nachdem was man für Infos braucht. Das wäre inklusiv. Jetzt fühlt es sich an wie Abwarten und Aushalten. Hilflos.
Und, was machen wir jetzt? Will ich das noch 24 Dienstjahre lang machen?
In meinen Texten kommt mir zu oft der Konjunktiv vor. Schade.